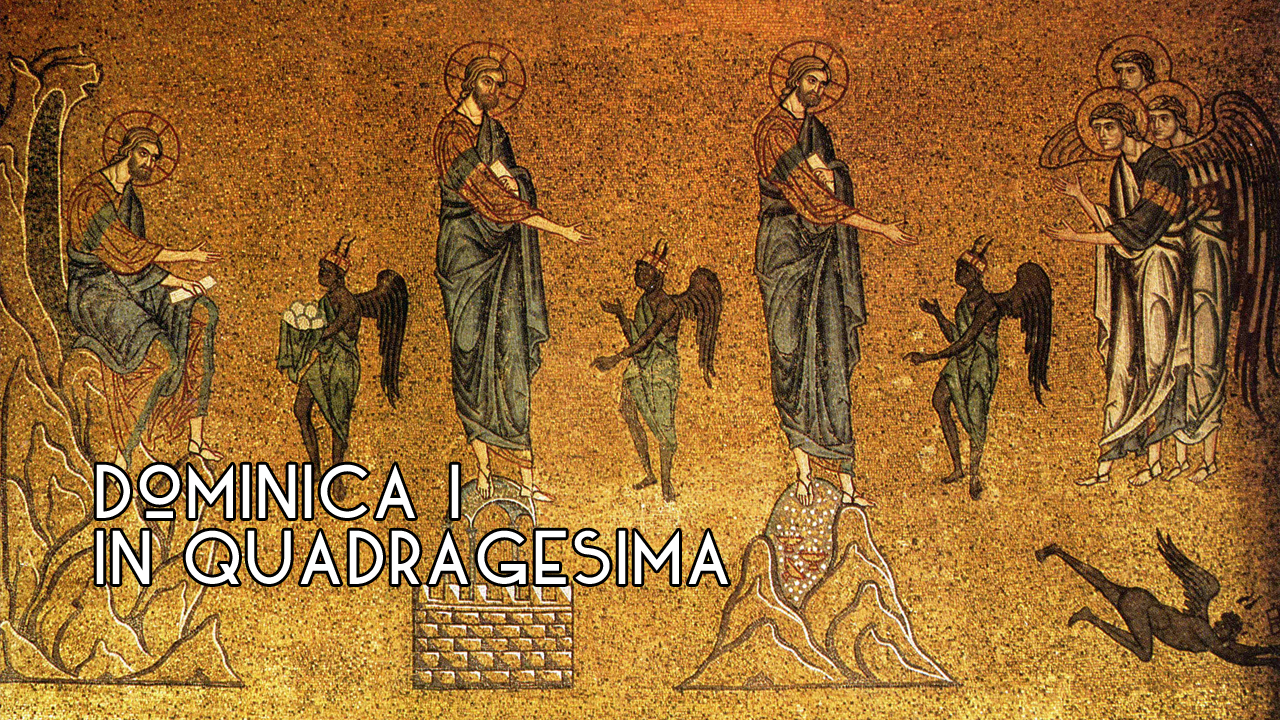Andrea Tornielli hat bei vaticannews eine Predigt von Kardinal Joseph Ratzinger über das Wesen der Kirche aus dem Jahr 1981 veröffentlicht. Hier geht´s zum Original: klicken
"RATZINGER UND DIE KIRCHE ALS RAUM DER AUFNAHME, DER FREIHEIT LÄSST"
Bislang nur auf Deutsch, jetzt erstmals auf Italienisch veröffentlicht: In einer Predigt stellt der damalige Kardinal Ratzinger die heilige Monika und ihre Haltung gegenüber ihrem Sohn, dem heiligen Augustinus, als Personifikation der kirchlichen Gemeinschaft dar: Raum des Lebens, der Aufnahme, der Freiheit, in dem die Freiheit eines jeden respektiert wird und der Glaube niemals aufgezwungen wird.Die Kirche als Person, nicht als Apparat
Der damalige Erzbischof von München und Freising stellt in der Predigt die Gestalt der Mutter des Augustinus als lebendige Erfahrung dessen vor, was die Kirche in ihrem tiefsten Wesen ist. „In ihr“, schreibt Ratzinger mit Bezug auf den Heiligen von Hippo, „hat er die Kirche als Person erlebt, die Kirche persönlich, so dass sie für ihn nicht irgendein Apparat war, von dem man von weit oben etwas hört, Strukturen, die einem etwas undurchsichtig sind. In dieser Frau war das, was Kirche ist, persönlich da.“ Augustinus, erinnerte der Kardinal, schrieb über seine Mutter: „Sie hat mir nicht nur dieses körperliche Leben geschenkt, sondern sie hat mir einen Raum des Herzens geschenkt, einen Raum des Lebens eingeräumt, in dem ich ein Mensch werden konnte.“ Der Mensch, so Ratzinger, „braucht einen Bezugsraum des Vertrauens, der Liebe und eines Sinnes, der ihn in die Zukunft gehen lässt.
„Das Gesicht einer einladenend, aufnehmenden Kirche, die die Freiheit aller und die Rhythmen eines jeden respektiert“
Doch dieser „Raum des Lebens“ hat wenig zu tun mit kirchlichen Strukturen oder mit identitären Gemeinschaften von Vollkommenen, die sich von der Welt isolieren und diese Tag für Tag neu verurteilen. Im Gegenteil, er zeichnet auf wunderbare Weise das Gesicht einer einladenend, aufnehmenden Kirche, die die Freiheit aller und die Rhythmen eines jeden respektiert. Genau so, wie Monika es mit ihrem Sohn getan hat, indem sie es als „wesentliches Element für dieses Eröffnen von Lebensraum angesehen, ihm Freiheit zu lassen“. Frei sich zu irren, frei, seinen körperlichen Begierden zu folgen… Monika „hat warten können. Sie hat den Konflikt der Generationen annehmen können. Sie hat leidend gelernt, ihn auf seinem Weg zu lassen, ohne Zwang. Sie hat gelernt, auszuhalten, dass sein Weg ein ganz anderer war, als der, den sie im Glauben für ihn erkannt hatte, und dennoch ihm gut zu bleiben, für ihn da zu sein, nicht ihn loszulassen und doch ihm die Freiheit seines Seins zu lassen. In diesem wartenden Offensein, in dem sie ihm die Freiheit ließ, er selber zu werden, indem sie ihm den Glauben nicht aufnötigte, sondern nur einfach Mensch, Mutter, für ihn war, gerade vermittelt sie Glauben.“
Das sind erhellende Worte für Eltern, für Erzieher und ganz allgemein für jene, die das Evangelium verkünden. Eine Kirche als „Raum des Lebens, der Freiheit, der Hoffnung“.
Raum des Lebens, der Freiheit, der Hoffnung
Der künftige Papst kommentierte: „Ich glaube, dass es heute deswegen so viel Misstrauen und Abneigung gegenüber der Kirche gibt… weil wir die Kirche so wenig als Person, so wenig persönlich erleben. Wir hören von ihr nur als Struktur, Amt und Apparat. Aber Kirche wird nur bestehen können, wir uns nur in sie einwurzeln und sie uns nur Heimat machen können, wenn sie immerfort wieder in Personen da ist. Dazu sollte dieser Raum, das Raumganze, auch die Räume, in denen wir dann Freizeit und Begegnunt haben, Raum sein, der uns hilft, Kirche in Person füreinander zu werden; Raum, der für uns Lebensraum ist, Mutter, ein Jemand, der uns einen Ort des Vertrauens und des Lebenkönnens einräumt.“
Eine Kirche als „Feldlazarett“, die dich begleitet, in der die Liebe die tiefsten Wunden heilt und man sich zu Hause fühlt."
Die Predigt ist auf Deutsch veröffentlicht in den gesammelten Schriften Joseph Ratzingers/Benedikt XVI. im Band Kirche – Zeichen unter den Völkern (Gesammelte Schriften Bd. 8/2)
Quelle: A. Tornielli, vaticannews